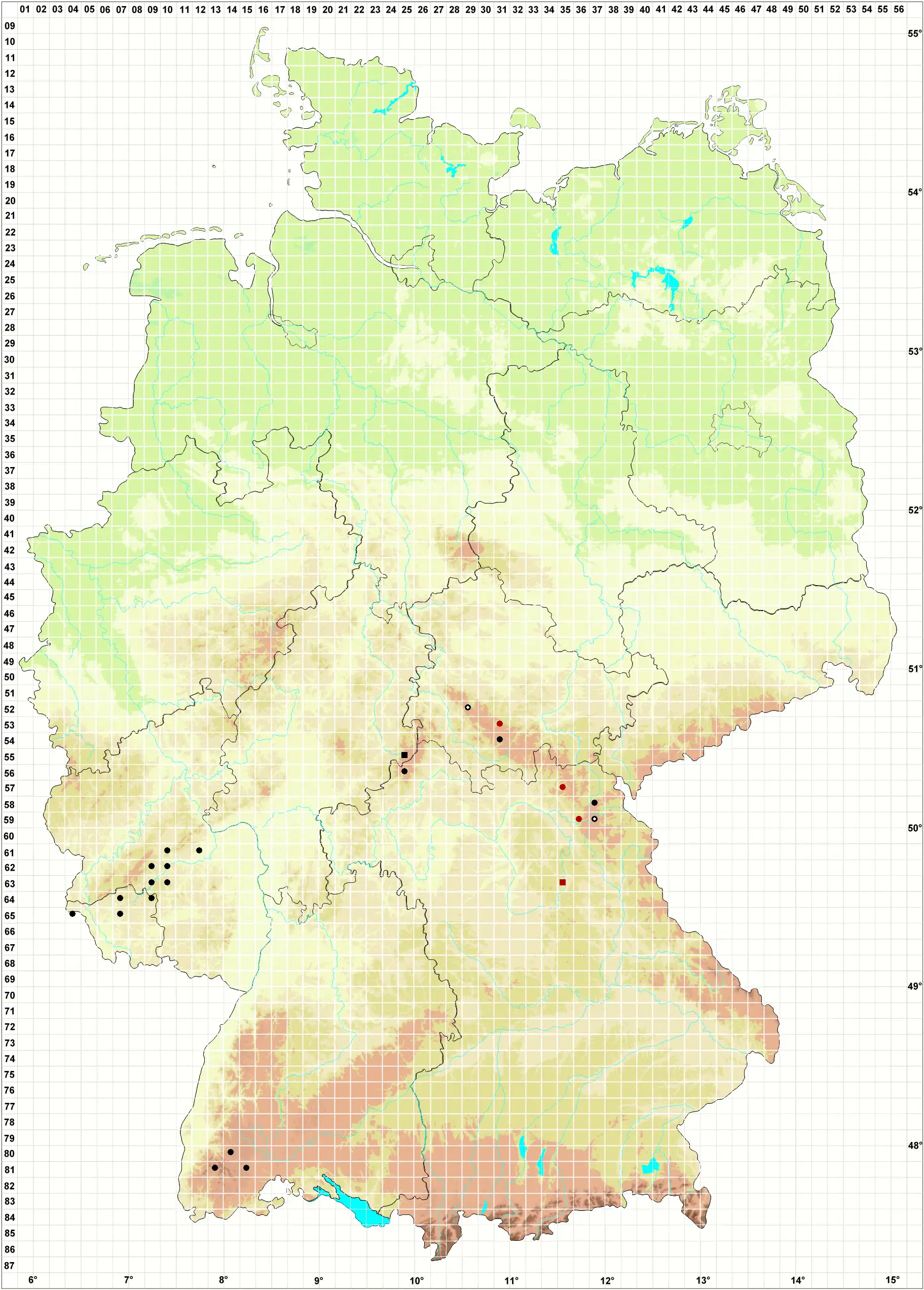Neckera menziesii Drumm.
Musci Amer., Brit. N. Amer.: 162. 1828
Deutscher Name: Rippenblatt-Neckermoos, Geschwollenes Neckermoos
Systematik: Equisetopsida > Bryidae > Thuidiaceae > Hypnales > Neckeraceae > Neckera
Synonyme: Metaneckera menziesii (Drumm.) Steere, Neckeradelphus menziesii (Drumm.) Steere, Neckera mediterranea H.Philib., Neckera turgida Jur.
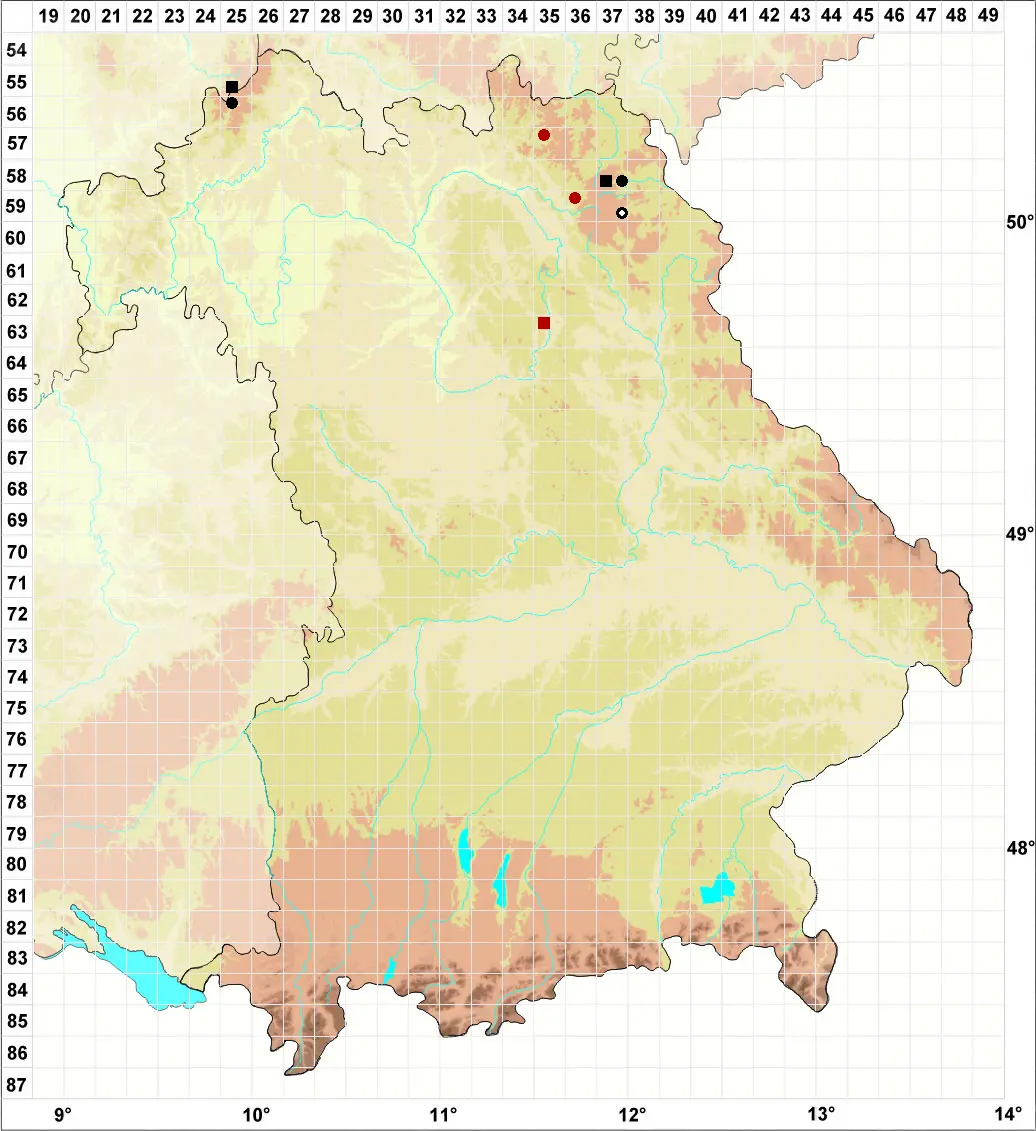
In unserer Datenbank gibt es 14 Datensätze .
Bitte klicken Sie die Karte für Details. [ Verbreitung in Deutschland ]
[ Verbreitung in Deutschland ]
Fertilität
Höhenverteilung
Rote Liste
- Deutschland (2018): 3
- Bayern (2019): R / Alpen: - / kontinental: R
Dürhammer, O. & M. Reimann (2019): Rote Liste und Gesamtartenliste der Moose (Bryophyta) Bayerns. – Bayerisches Landesamt für Umwelt Hrsg., Augsburg, 84 S.
Gebietseinteilungalpin: Alpen mit voralpinem Hügel- und Moorland
kontinental: Übriges Bayern
Gefährdungskategorien
Rote Liste 0 (Ausgestorben oder verschollen)
Rote Liste 1 (Vom Aussterben bedroht)
Rote Liste 2 (Stark gefährdet)
Rote Liste 3 (Gefährdet)
Rote Liste G (Gefährdung unbekannten Ausmaßes)
Rote Liste R (Wegen Seltenheit gefährdete Arten)
V Vorwarnliste
D Daten unzureichend
* Ungefährdet
♦ Nicht bewertet
Beschreibung der Art
Verwandte Arten
- → Neckera besseri (Lobarz.) Jur.
- → Neckera complanata (Hedw.) Huebener
- → Neckera complanata var. longifolia Schimp.
- → Neckera complanata var. obtusa Lindb.
- → Neckera complanata var. secunda Grav.
- → Neckera complanata var. tenella Schimp.
- → Neckera crispa Hedw.
- → Neckera crispa var. falcata Müll.Hal.
- → Neckera curtipendula Timm ex Hedw.
- → Neckeradelphus menziesii (Drumm.) Steere
- → Neckera fontinaloides Lindb.
- → Neckera fontinaloides var. philippeana (Schimp.) Guim.
- → Neckera heteromalla Hedw.
- → Neckera mediterranea H.Philib.
- → Neckera pennata Hedw.
- → Neckera philippeana Schimp.
- → Neckera pseudopennata (Warnst.) Schlieph. ex Zmuda
- → Neckera pumila Hedw.
- → Neckera pumila var. philippeana (Schimp.) Milde
- → Neckera pumila var. pilifera Jur.
- → Neckera sendtneriana Schimp.
- → Neckera turgida Jur.
- → Neckera viticulosa Hedw.