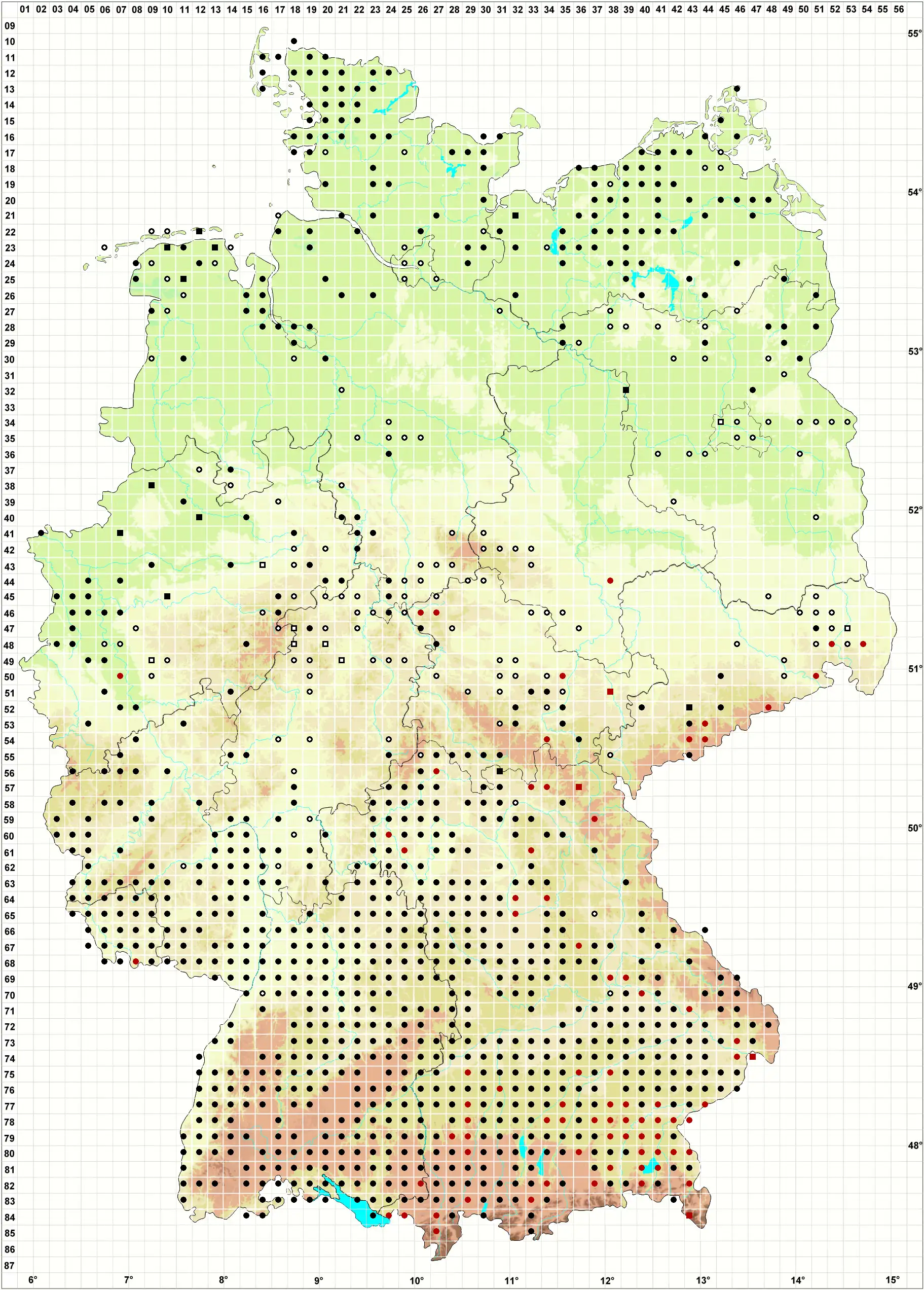Syntrichia papillosa (Wilson) Jur.
Cat. Musc. per Annos 1849--1860 legit Ricardus Spruceus 3. 1867.
Deutscher Name: Papillen-Verbundzahnmoos
Systematik: Equisetopsida > Bryidae > Pottiaceae > Pottiales > Pottiaceae > Syntrichia
Synonyme: Tortula papillosa var. meridionalis Warnst., Tortula papillosa Wilson, Tortula rotundifolia Hartm.
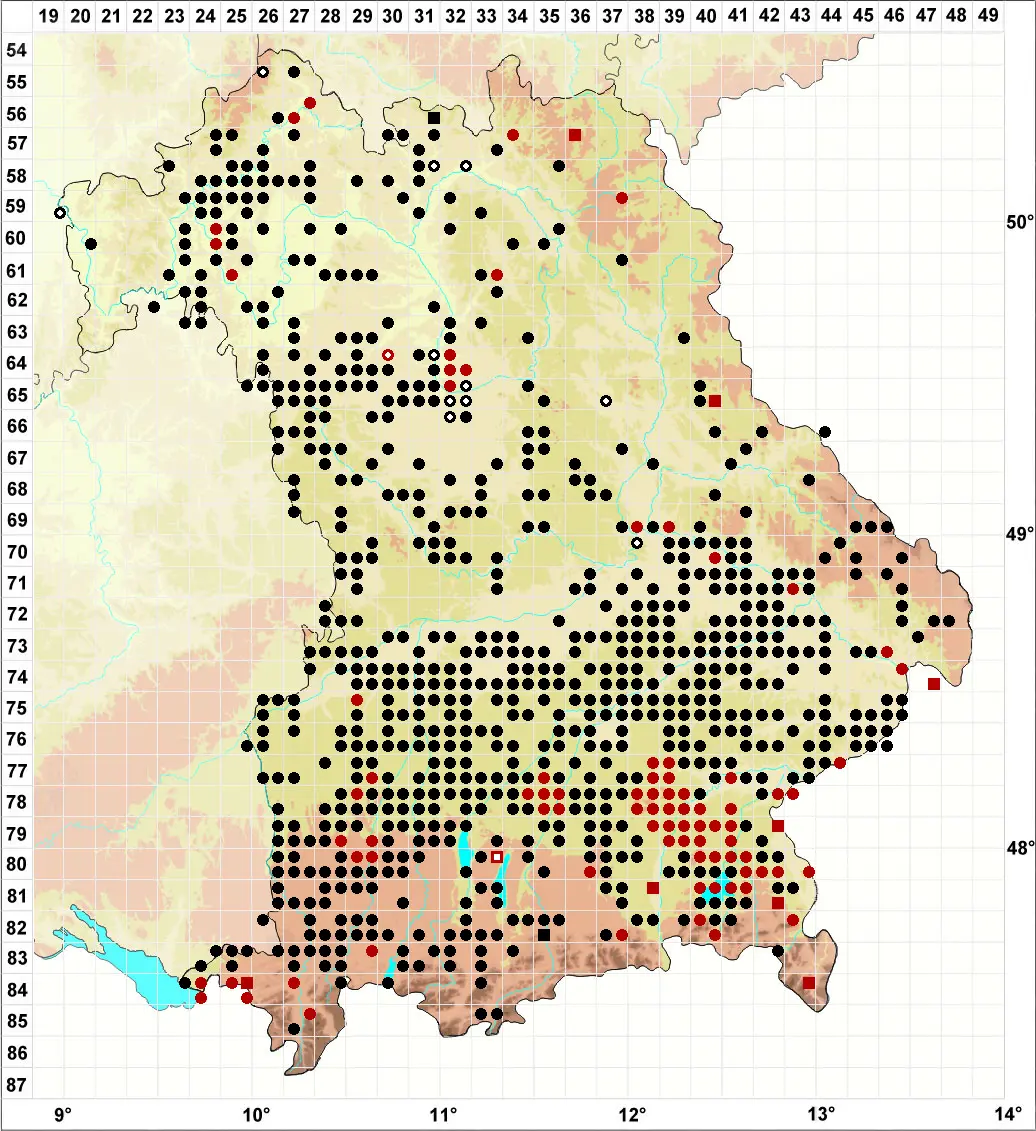
In unserer Datenbank gibt es 950 Datensätze .
Bitte klicken Sie die Karte für Details. [ Verbreitung in Deutschland ]
[ Verbreitung in Deutschland ]
Fertilität
Höhenverteilung
Rote Liste
- Deutschland (2018): *
- Bayern (2019): * / Alpen: * / kontinental: *
Dürhammer, O. & M. Reimann (2019): Rote Liste und Gesamtartenliste der Moose (Bryophyta) Bayerns. – Bayerisches Landesamt für Umwelt Hrsg., Augsburg, 84 S.
Gebietseinteilungalpin: Alpen mit voralpinem Hügel- und Moorland
kontinental: Übriges Bayern
Gefährdungskategorien
Rote Liste 0 (Ausgestorben oder verschollen)
Rote Liste 1 (Vom Aussterben bedroht)
Rote Liste 2 (Stark gefährdet)
Rote Liste 3 (Gefährdet)
Rote Liste G (Gefährdung unbekannten Ausmaßes)
Rote Liste R (Wegen Seltenheit gefährdete Arten)
V Vorwarnliste
D Daten unzureichend
* Ungefährdet
♦ Nicht bewertet
Beschreibung der Art
Habitat/Ökologie (Meinunger & Schröder 2007)
Verbreitung (Meinunger & Schröder 2007)
Bestand und Gefährdung (Meinunger & Schröder 2007)
Verwandte Arten
- → Syntrichia alpina (Bruch & Schimp.) Jur.
- → Syntrichia calcicola J.J.Amann
- → Syntrichia inermis (Brid.) Bruch
- → Syntrichia intermedia Brid.
- → Syntrichia laevipila Brid.
- → Syntrichia laevipila var. laevipilaeformis (De Not.) J.J.Amann
- → Syntrichia laevipila var. pagorum (Milde) Mönk.
- → Syntrichia latifolia (Bruch ex Hartm.) Huebener
- → Syntrichia montana Nees
- → Syntrichia montana Nees var. montana
- → Syntrichia montana var. calva (Durieu & Sagot ex Bruch & Schimp.) J.J.Amann
- → Syntrichia mucronifolia (Schwägr.) Brid.
- → Syntrichia norvegica F.Weber
- → Syntrichia pagorum (Milde) J.J.Amann
- → Syntrichia princeps (De Not.) Mitt.
- → Syntrichia princeps (De Not.) Mitt. var. princeps
- → Syntrichia pulvinata (Jur.) Jur.
- → Syntrichia ruraliformis (Besch.) Cardot
- → Syntrichia ruralis (Hedw.) F.Weber & D.Mohr
- → Syntrichia ruralis (Hedw.) F.Weber & D.Mohr var. ruralis
- → Syntrichia ruralis var. arenicola (Braithw.) J.J. Amann
- → Syntrichia ruralis var. calcicola (J.J.Amann) Mönk.
- → Syntrichia ruralis var. glacialis J.J.Amann
- → Syntrichia ruralis var. norvegica (F.Weber) Steud.
- → Syntrichia ruralis var. ruraliformis (Besch.) Delogne
- → Syntrichia sinensis (Müll.Hal.) Ochyra
- → Syntrichia subpapillosissima (Bizot & R.B.Pierrot ex W.A.Kramer) M.T.Gallego & J.Guerra
- → Syntrichia subulata (Hedw.) F.Weber & D.Mohr
- → Syntrichia subulata var. inermis Brid.
- → Syntrichia virescens (De Not.) Ochyra
- → Syntrichia virescens (De Not.) Ochyra var. virescens