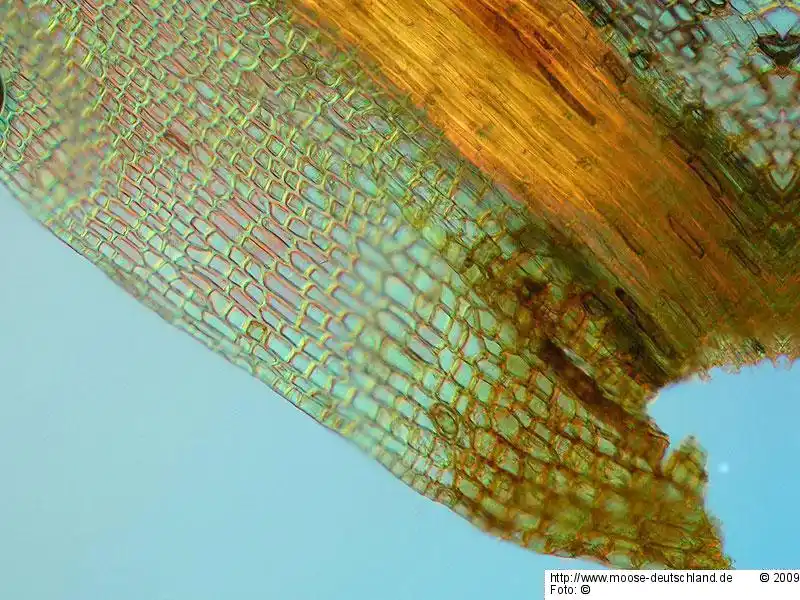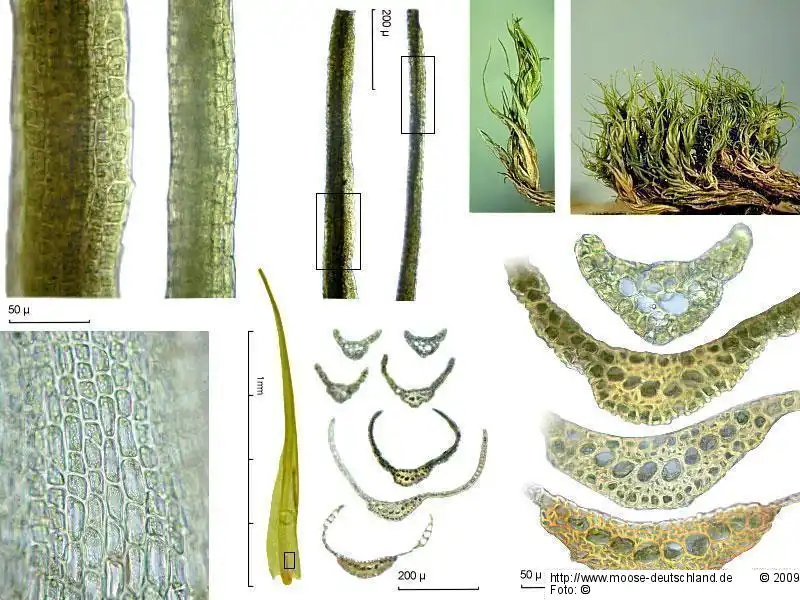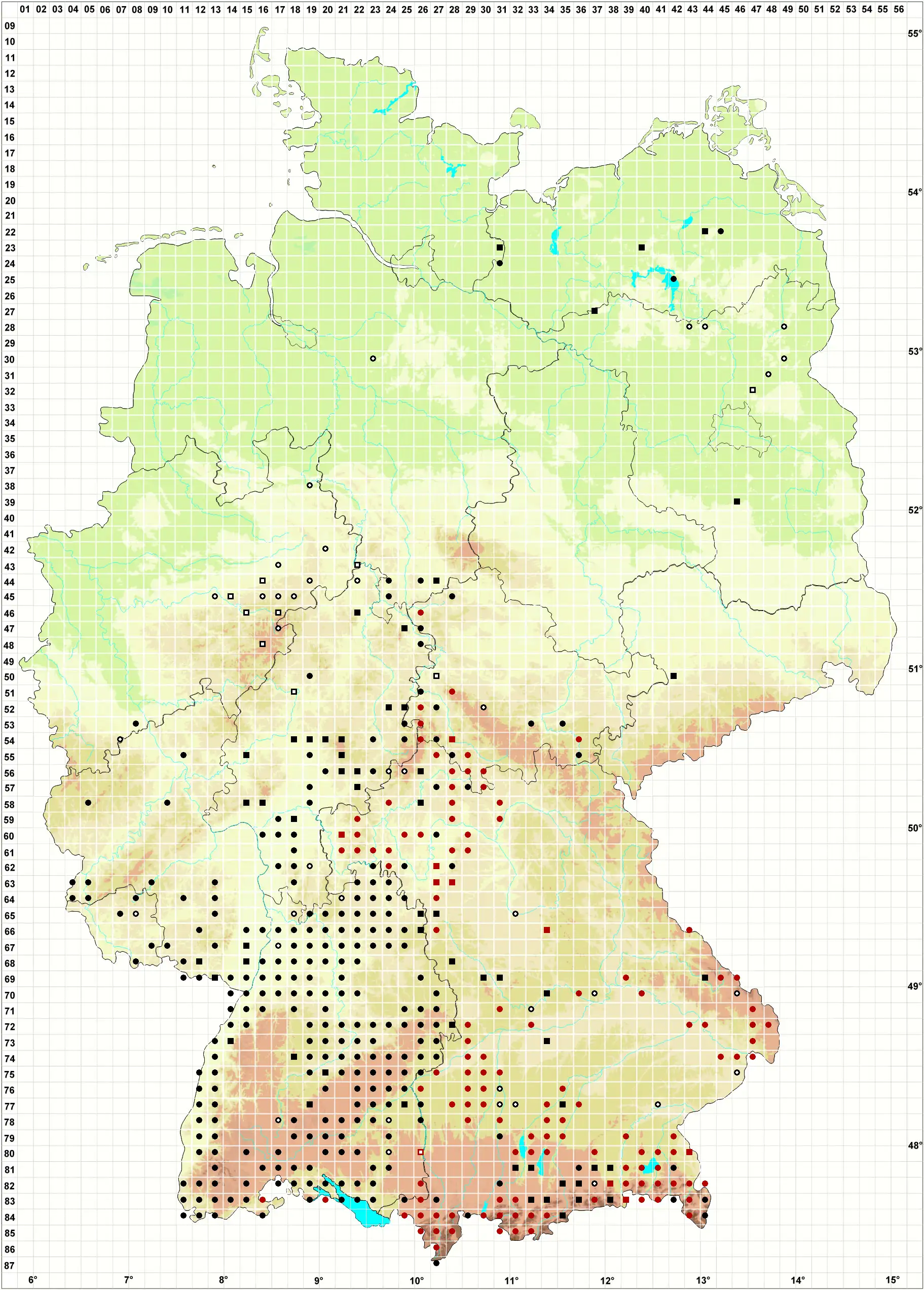In unserer Datenbank gibt es 597 Datensätze .
Bitte klicken Sie die Karte für Details. [ Verbreitung in Deutschland ]
[ Verbreitung in Deutschland ]
Fertilität
Höhenverteilung
Rote Liste
- FFH: II
- Deutschland (2018): V
- Bayern (2019): V / Alpen: * / kontinental: V
[ x ]
alpin: Alpen mit voralpinem Hügel- und Moorland
kontinental: Übriges Bayern
Gefährdungskategorien
Rote Liste 0 (Ausgestorben oder verschollen)
Rote Liste 1 (Vom Aussterben bedroht)
Rote Liste 2 (Stark gefährdet)
Rote Liste 3 (Gefährdet)
Rote Liste G (Gefährdung unbekannten Ausmaßes)
Rote Liste R (Wegen Seltenheit gefährdete Arten)
V Vorwarnliste
D Daten unzureichend
* Ungefährdet
♦ Nicht bewertet
Dürhammer, O. & M. Reimann (2019): Rote Liste und Gesamtartenliste der Moose (Bryophyta) Bayerns. – Bayerisches Landesamt für Umwelt Hrsg., Augsburg, 84 S.
Gebietseinteilungalpin: Alpen mit voralpinem Hügel- und Moorland
kontinental: Übriges Bayern
Gefährdungskategorien
Rote Liste 0 (Ausgestorben oder verschollen)
Rote Liste 1 (Vom Aussterben bedroht)
Rote Liste 2 (Stark gefährdet)
Rote Liste 3 (Gefährdet)
Rote Liste G (Gefährdung unbekannten Ausmaßes)
Rote Liste R (Wegen Seltenheit gefährdete Arten)
V Vorwarnliste
D Daten unzureichend
* Ungefährdet
♦ Nicht bewertet
Beschreibung der Art
Habitat/Ökologie (Meinunger & Schröder 2007)
Verbreitung (Meinunger & Schröder 2007)
Bestand und Gefährdung (Meinunger & Schröder 2007)
Verwandte Arten
- → Dicranum aciculare Hedw.
- → Dicranum affine Funck
- → Dicranum albicans Bruch & Schimp.
- → Dicranum ambiguum Hedw.
- → Dicranum asperulum Mitt.
- → Dicranum bergeri Blandow
- → Dicranum blyttii Bruch & Schimp.
- → Dicranum bonjeanii De Not.
- → Dicranum brevifolium (Lindb.) Lindb.
- → Dicranum bruntonii Sm.
- → Dicranum cerviculatum Hedw.
- → Dicranum congestum Brid.
- → Dicranum congestum var. flexicaule (Brid.) Bruch & Schimp.
- → Dicranum crispum Hedw.
- → Dicranum denudatum Brid.
- → Dicranum dispersum Engelmark
- → Dicranum elongatum Schleich. ex Schwägr.
- → Dicranum elongatum var. sendtneri (Limpr.) Mönk.
- → Dicranum enerve Thed.
- → Dicranum falcatum Hedw.
- → Dicranum flagellare Hedw.
- → Dicranum flexicaule Brid.
- → Dicranum flexuosum Hedw.
- → Dicranum fragile Brid.
- → Dicranum fulvum Hook.
- → Dicranum fuscescens Sm.
- → Dicranum fuscescens var. congestum (Brid.) Kindb.
- → Dicranum fuscescens var. flexicaule (Brid.) Wilson
- → Dicranum glaucum Hedw.
- → Dicranum gracile Mitt.
- → Dicranum gracilescens F.Weber & D.Mohr
- → Dicranum heteromallum Hedw.
- → Dicranum introflexum Hedw.
- → Dicranum juniperoideum Brid.
- → Dicranum latifolium Hedw.
- → Dicranum longifolium Ehrh. ex Hedw.
- → Dicranum longifolium var. sauteri (Bruch & Schimp.) Velen.
- → Dicranum majus Sm.
- → Dicranum montanum Hedw.
- → Dicranum muehlenbeckii Bruch & Schimp.
- → Dicranum muehlenbeckii var. brevifolium Lindb.
- → Dicranum muehlenbeckii var. cirrhatum (Schimp.) Lindb.
- → Dicranum muehlenbeckii var. neglectum (De Not.) Pfeff.
- → Dicranum muehlenbeckii var. spadiceum (J.E.Zetterst.) Podp.
- → Dicranum neglectum Jur. ex De Not.
- → Dicranum ovale Hedw.
- → Dicranum palustre Bruch & Schimp.
- → Dicranum pellucidum Hedw.
- → Dicranum polyphyllum Sw.
- → Dicranum polysetum Sw.
- → Dicranum purpureum Hedw.
- → Dicranum pyriformis Schultz
- → Dicranum rugosum Hoffm. ex Brid.
- → Dicranum sauteri Bruch & Schimp.
- → Dicranum saxatile Lag.
- → Dicranum saxicola F.Weber & D.Mohr
- → Dicranum schisti Lindb.
- → Dicranum schraderi Wahlenb.
- → Dicranum schreberianum Hedw.
- → Dicranum schreberi var. grevilleanum Brid.
- → Dicranum scoparium Hedw.
- → Dicranum sendtneri Limpr.
- → Dicranum spadiceum J.E.Zetterst.
- → Dicranum spurium Hedw.
- → Dicranum starkei F.Weber & D.Mohr
- → Dicranum strictum Schleich. ex D.Mohr
- → Dicranum subulatum Hedw.
- → Dicranum tauricum Sapjegin
- → Dicranum undulatum Ehrh. ex F.Weber & D.Mohr
- → Dicranum undulatum Schrad. ex Brid.
- → Dicranum undulatum Turner
- → Dicranum varium Hedw.
- → Dicranum virens Hedw.
- → Dicranum viridulum Sw. ex. anon.