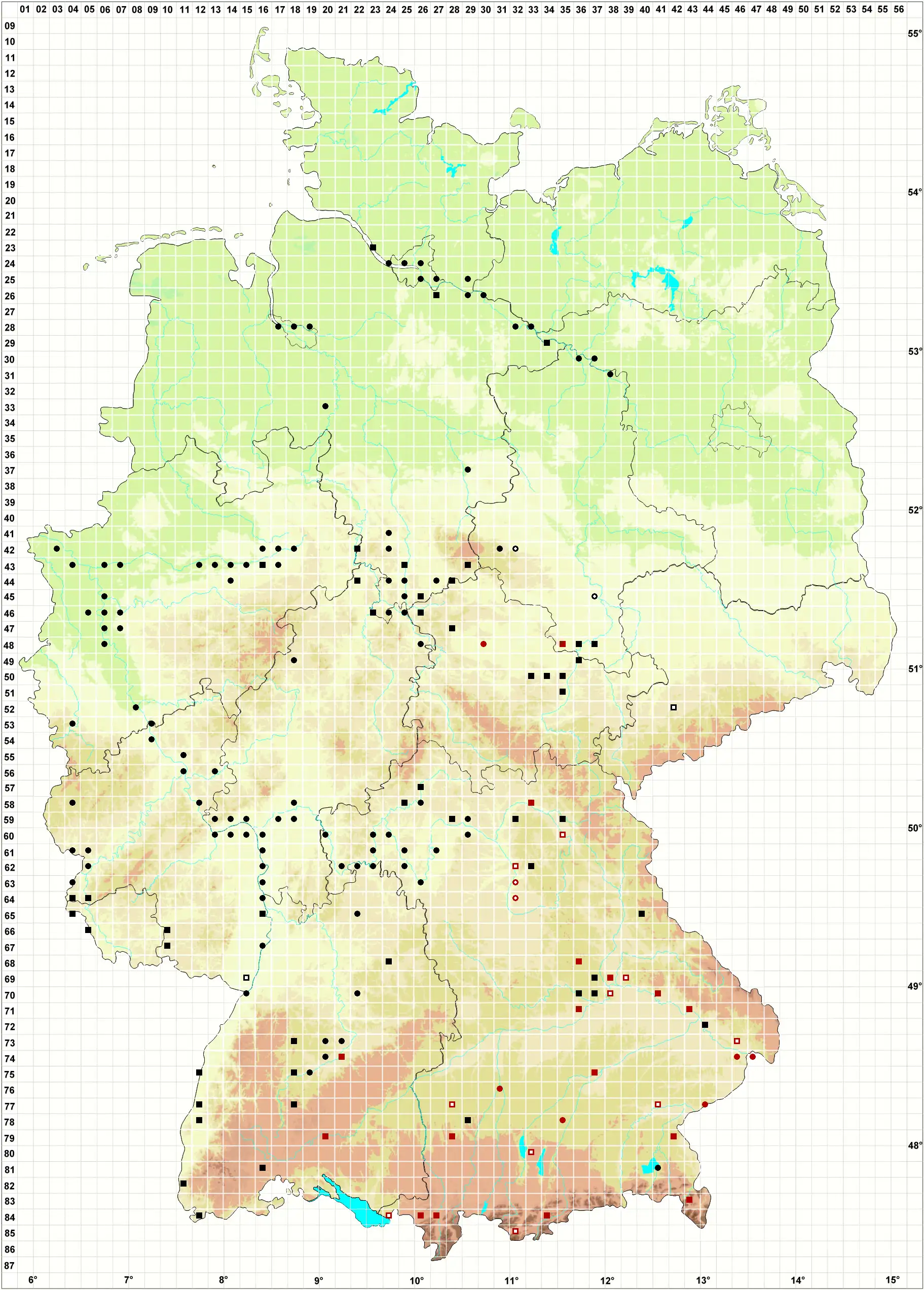Fissidens crassipes Wilson ex Bruch & Schimp.
Bryol. Eur. 1: 197. 1849
Deutscher Name: Dickstieliges Spaltzahnmoos
Systematik: Equisetopsida > Bryidae > Fissidentaceae > Fissidentales > Fissidentaceae > Fissidens
Synonyme: Fissidens crassipes subsp. warnstorfii (M.Fleisch.) Brugg.-Nann., Fissidens crassipes var. mildeanus (Schimp.) Mönk., Fissidens crassipes var. philibertii Besch., Fissidens crassipes var. rufipes Schimp., Fissidens crassipes var. submarginatus M.Fleisch. & Warnst., Fissidens crassipes Wilson ex Bruch & Schimp. subsp. crassipes, Fissidens mildeanus Schimp., Fissidens warnstorfii M.Fleisch.
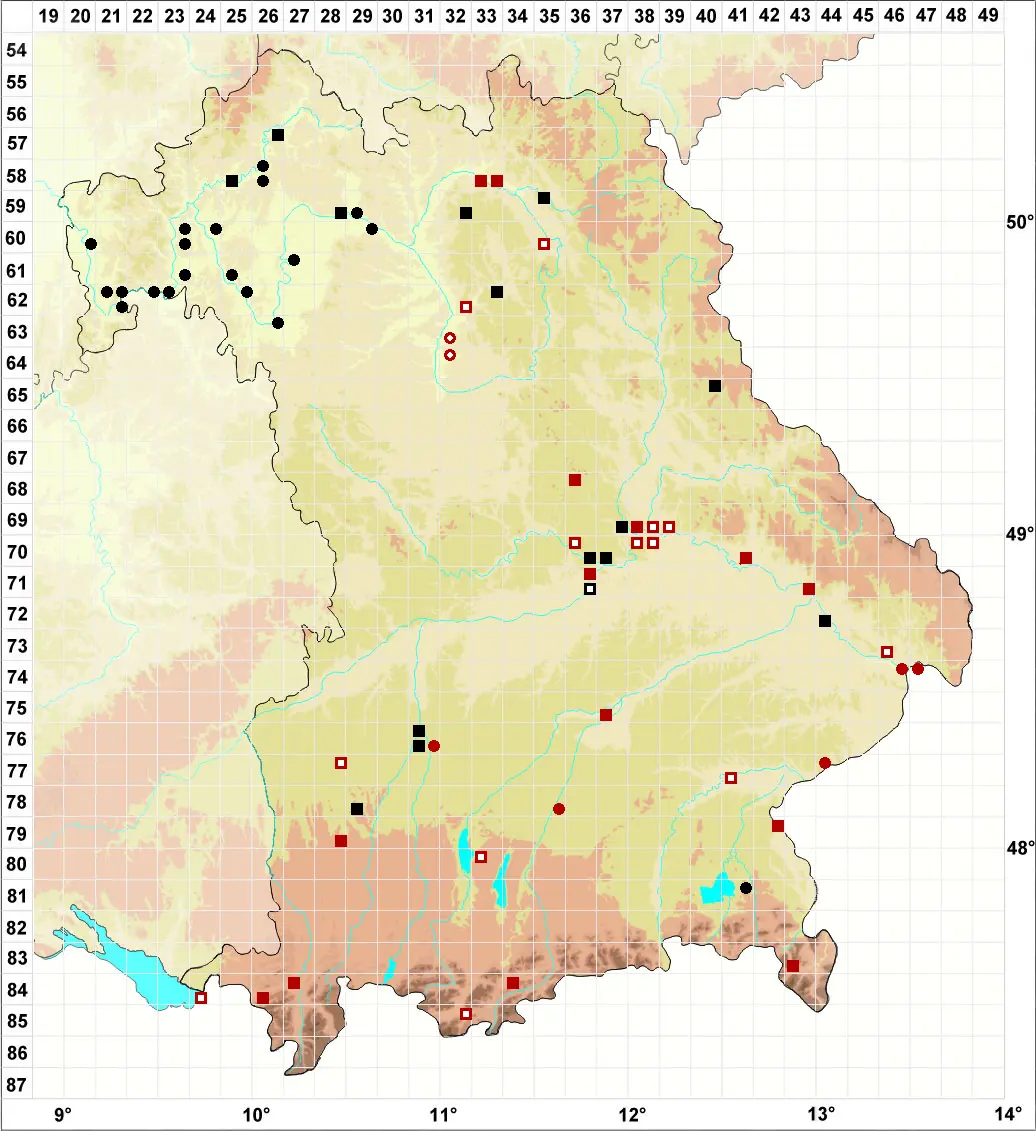
In unserer Datenbank gibt es 93 Datensätze .
Bitte klicken Sie die Karte für Details. [ Verbreitung in Deutschland ]
[ Verbreitung in Deutschland ]
Fertilität
Höhenverteilung
Rote Liste
- Deutschland (2018): *
- Bayern (2019): 3 / Alpen: D / kontinental: 3
Dürhammer, O. & M. Reimann (2019): Rote Liste und Gesamtartenliste der Moose (Bryophyta) Bayerns. – Bayerisches Landesamt für Umwelt Hrsg., Augsburg, 84 S.
Gebietseinteilungalpin: Alpen mit voralpinem Hügel- und Moorland
kontinental: Übriges Bayern
Gefährdungskategorien
Rote Liste 0 (Ausgestorben oder verschollen)
Rote Liste 1 (Vom Aussterben bedroht)
Rote Liste 2 (Stark gefährdet)
Rote Liste 3 (Gefährdet)
Rote Liste G (Gefährdung unbekannten Ausmaßes)
Rote Liste R (Wegen Seltenheit gefährdete Arten)
V Vorwarnliste
D Daten unzureichend
* Ungefährdet
♦ Nicht bewertet
Beschreibung der Art
Habitat/Ökologie (Meinunger & Schröder 2007)
Verbreitung (Meinunger & Schröder 2007)
Bestand und Gefährdung (Meinunger & Schröder 2007)
Verwandte Arten
- → Fissidens adianthoides Hedw.
- → Fissidens alpestris (Lindb.) J.J.Amann
- → Fissidens arnoldii R.Ruthe
- → Fissidens bambergeri Schimp. ex Milde
- → Fissidens bloxamii Wilson
- → Fissidens bryoides Hedw.
- → Fissidens bryoides Hedw. var. bryoides
- → Fissidens bryoides subsp. incurvus (Röhl.) Bertsch
- → Fissidens bryoides subsp. viridulus (Sw.) Kindb.
- → Fissidens bryoides var. gymnandrus (Büse) R.Ruthe
- → Fissidens bryoides var. hedwigii Limpr.
- → Fissidens bryoides var. inconstans (Schimp.) R.Ruthe
- → Fissidens bryoides var. intermedius R.Ruthe
- → Fissidens bryoides var. rivularis Spruce
- → Fissidens bryoides var. viridulus (Sw. ex anon.) Broth.
- → Fissidens celticus Paton
- → Fissidens crassipes subsp. warnstorfii (M.Fleisch.) Brugg.-Nann.
- → Fissidens crassipes var. mildeanus (Schimp.) Mönk.
- → Fissidens crassipes var. philibertii Besch.
- → Fissidens crassipes var. rufipes Schimp.
- → Fissidens crassipes var. submarginatus M.Fleisch. & Warnst.
- → Fissidens crassipes Wilson ex Bruch & Schimp. subsp. crassipes
- → Fissidens cristatus Wilson ex Mitt.
- → Fissidens decipiens De Not.
- → Fissidens decumbens R.Ruthe
- → Fissidens dubius P.Beauv.
- → Fissidens exiguus auct. eur. partim (1)
- → Fissidens exiguus auct. eur. partim (2)
- → Fissidens exiguus Sull.
- → Fissidens exilis Hedw.
- → Fissidens fontanus (Bach. Pyl.) Steud.
- → Fissidens gracilifolius Brugg.-Nann. & Nyholm
- → Fissidens grandifrons Brid.
- → Fissidens gymnandrus Büse
- → Fissidens haraldii (Lindb.) Limpr.
- → Fissidens hydrophilus A.Jaeger
- → Fissidens impar Mitt.
- → Fissidens inconstans Schimp.
- → Fissidens incurvus Starke ex Röhl.
- → Fissidens incurvus var. tamarindifolius (Turner) Braithw.
- → Fissidens intralimbatus R.Ruthe
- → Fissidens julianus (Lam. & DC.) Schimp.
- → Fissidens limbatus var. bambergeri (Milde) Düll
- → Fissidens marginatulus Meln.
- → Fissidens mildeanus Schimp.
- → Fissidens minutulus auct.
- → Fissidens monguillonii Thér.
- → Fissidens obtusifolius auct. germ. non Wilson
- → Fissidens osmundoides Hedw.
- → Fissidens pallidicaulis Mitt.
- → Fissidens polycarpus Hedw.
- → Fissidens pulvinatus Timm ex Hedw.
- → Fissidens pulvinatus var. africanus Hedw.
- → Fissidens pusillus var. minutulus (Sull.) Husn.
- → Fissidens pusillus (Wilson) Milde
- → Fissidens pyrenaicus Spruce
- → Fissidens rivularis (Spruce) Schimp.
- → Fissidens rivularis var. monguillonii (Thér.) Podp.
- → Fissidens rufulus Bruch & Schimp.
- → Fissidens rupestris Wilson
- → Fissidens sardous De Not.
- → Fissidens sciuroides Hedw.
- → Fissidens strumifer Hedw.
- → Fissidens subimmarginatus H.Philib.
- → Fissidens tamarindifolius (Turner) Brid.
- → Fissidens taxifolius Hedw.
- → Fissidens taxifolius Hedw. subsp. taxifolius
- → Fissidens velenovskyi Podp.
- → Fissidens ventricosus Lesq.
- → Fissidens viridulus (Sw.) Wahlenb.
- → Fissidens viridulus (Sw.) Wahlenb. var. viridulus
- → Fissidens viridulus var. bambergeri (Milde) Waldh.
- → Fissidens viridulus var. haraldii (Lindb.) C.E.O.Jensen
- → Fissidens viridulus var. incurvus (Starke ex Röhl.) Waldh.
- → Fissidens viridulus var. intralimbatulus (R.Ruthe) Düll
- → Fissidens viridulus var. pusillus Wilson
- → Fissidens viridulus var. tenuifolius (Boulay) A.J.E.Sm.
- → Fissidens warnstorfii M.Fleisch.