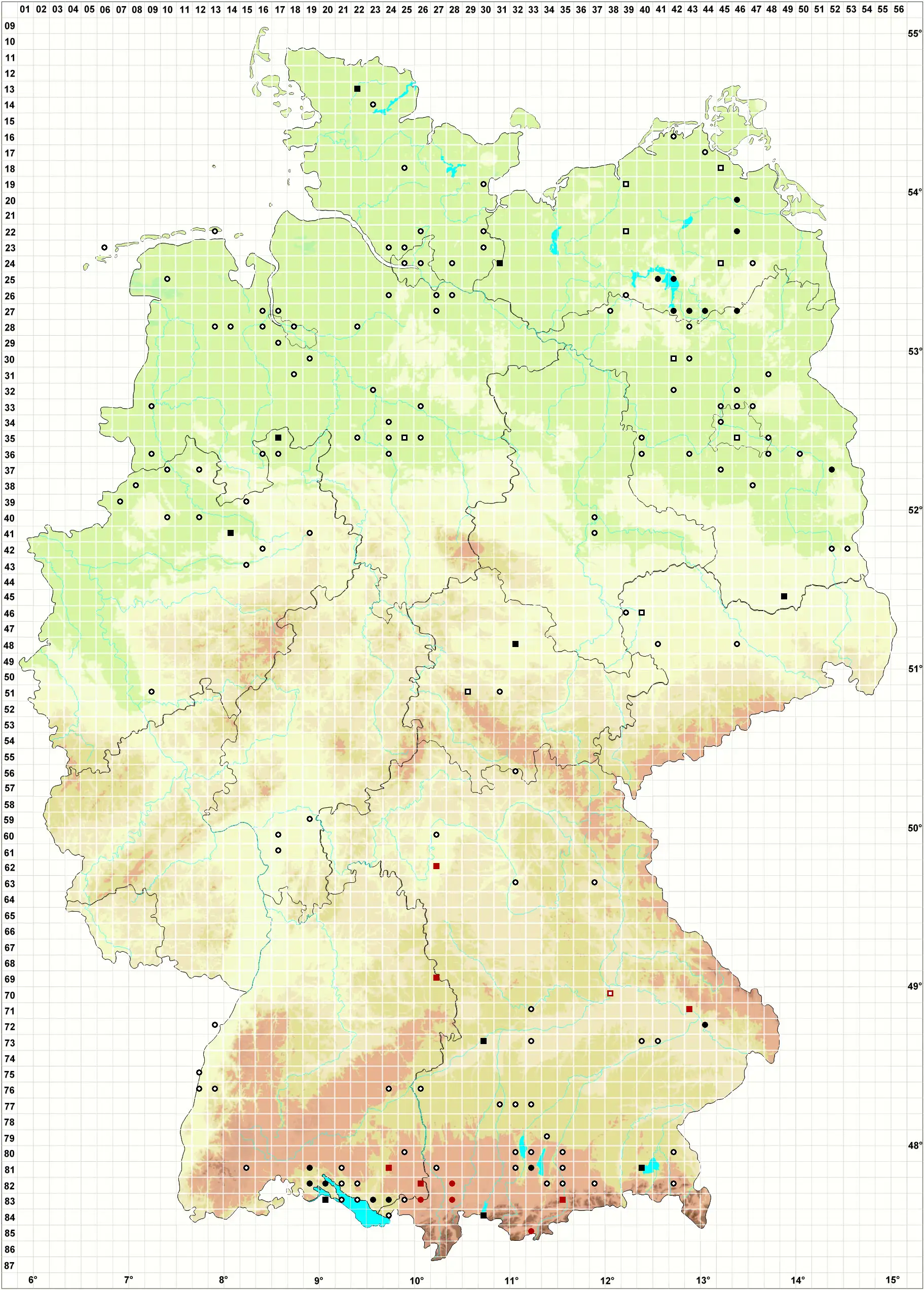Drepanocladus lycopodioides (Brid.) Warnst.
Beih. Bot. Centralbl. 14: 401. 1903
Deutscher Name: Bärlapp-Scheinschönmoos, Bärlapp-Sichelmoos
Systematik: Equisetopsida > Bryidae > Thuidiaceae > Hypnales > Amblystegiaceae
Synonyme: Hypnum lycopodioides Brid., Pseudocalliergon lycopodioides (Brid.) Hedenäs, Scorpidium lycopodioides (Brid.) H.K.G.Paul
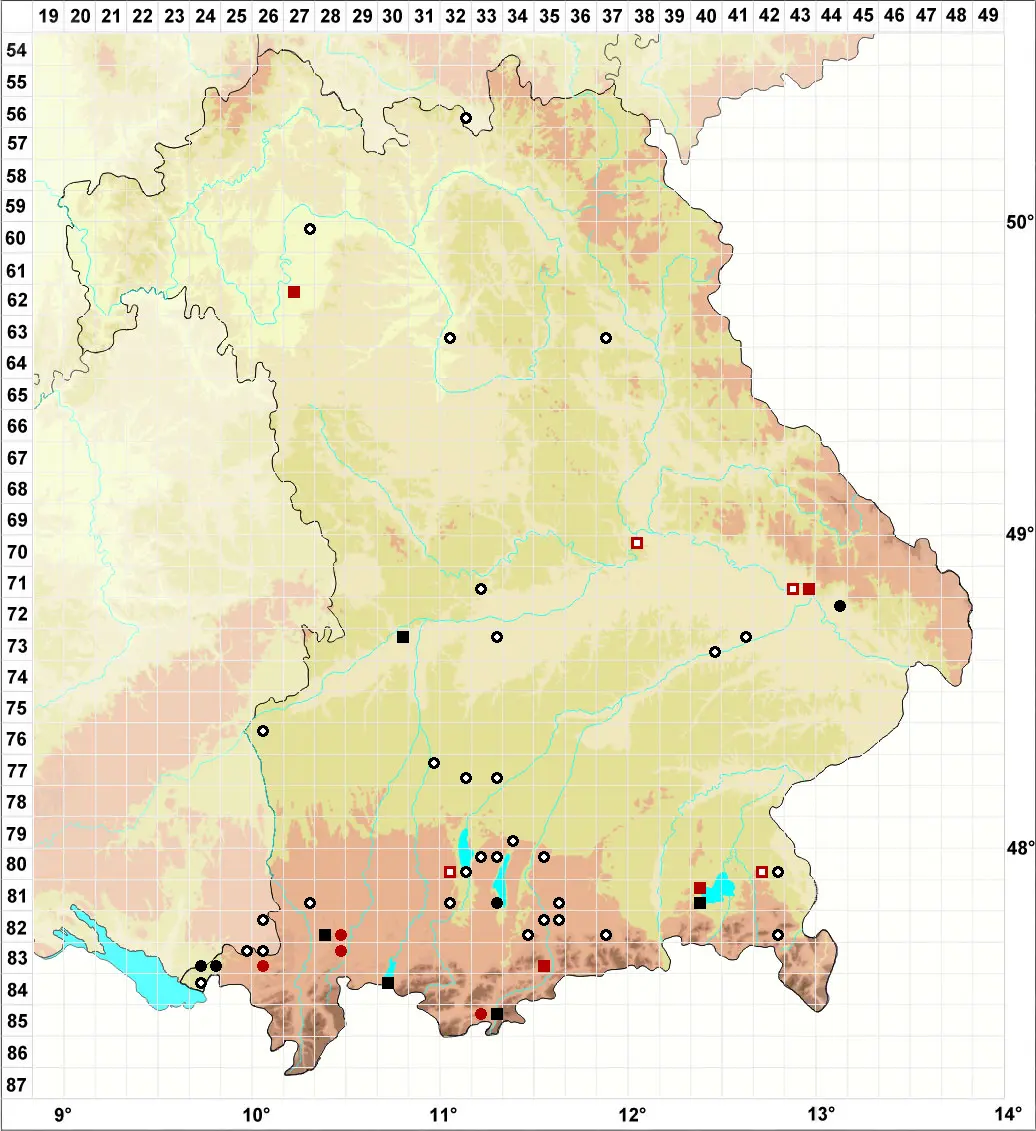
In unserer Datenbank gibt es 73 Datensätze .
Bitte klicken Sie die Karte für Details. [ Verbreitung in Deutschland ]
[ Verbreitung in Deutschland ]
Fertilität
Höhenverteilung
Rote Liste
- Deutschland (2018): 1
- Bayern (2019): 1 / Alpen: 1 / kontinental: 1
Dürhammer, O. & M. Reimann (2019): Rote Liste und Gesamtartenliste der Moose (Bryophyta) Bayerns. – Bayerisches Landesamt für Umwelt Hrsg., Augsburg, 84 S.
Gebietseinteilungalpin: Alpen mit voralpinem Hügel- und Moorland
kontinental: Übriges Bayern
Gefährdungskategorien
Rote Liste 0 (Ausgestorben oder verschollen)
Rote Liste 1 (Vom Aussterben bedroht)
Rote Liste 2 (Stark gefährdet)
Rote Liste 3 (Gefährdet)
Rote Liste G (Gefährdung unbekannten Ausmaßes)
Rote Liste R (Wegen Seltenheit gefährdete Arten)
V Vorwarnliste
D Daten unzureichend
* Ungefährdet
♦ Nicht bewertet
Beschreibung der Art
Habitat/Ökologie (Meinunger & Schröder 2007)
Verbreitung (Meinunger & Schröder 2007)
Bestand und Gefährdung (Meinunger & Schröder 2007)
Verwandte Arten
- → Drepanocladus aduncus f. capillifolia Mönk.
- → Drepanocladus aduncus (Hedw.) Warnst.
- → Drepanocladus aduncus (Hedw.) Warnst. var. aduncus
- → Drepanocladus aduncus var. eu-aduncus Mönk.
- → Drepanocladus aduncus var. kneiffii (Schimp.) Mönk.
- → Drepanocladus aduncus var. polycarpus (Voit) G.Roth
- → Drepanocladus aduncus var. pungens (Milde) Riehm.
- → Drepanocladus capillifolius (Warnst.) Warnst.
- → Drepanocladus cossonii (Schimp.) Loeske
- → Drepanocladus exannulatus (Schimp.) Warnst.
- → Drepanocladus fluitans (Hedw.) Warnst.
- → Drepanocladus fluitans var. eu-fluitans Mönk.
- → Drepanocladus fluitans var. falcatus (C.E.O.Jensen) G.Roth
- → Drepanocladus fluitans var. uncatus H.A.Crum, Steere & L.E.Anderson
- → Drepanocladus furcatus G.Roth & Bock
- → Drepanocladus h-schulzei (Limpr.) Loeske
- → Drepanocladus intermedius (Lindb.) Warnst.
- → Drepanocladus kneiffii (Schimp.) Warnst.
- → Drepanocladus lapponicus (Norrl.) Smirnova
- → Drepanocladus longifolius (Mitt.) Paris
- → Drepanocladus orthophyllus (Milde) Warnst.
- → Drepanocladus polycarpon (Bland. ex Voit) Warnst.
- → Drepanocladus polycarpus var. capillifolius Loeske
- → Drepanocladus polygamus (Schimp.) Hedenäs
- → Drepanocladus procerus (Renauld & Arnell) Warnst.
- → Drepanocladus pseudorufescens Warnst.
- → Drepanocladus pseudostramineus (Müll.Hal.) G.Roth
- → Drepanocladus purpurascens (Schimp.) Loeske
- → Drepanocladus revolvens (Sw. ex anon.) Warnst.
- → Drepanocladus revolvens var. intermedius (Lindb.) R. Wilson
- → Drepanocladus schulzei G.Roth
- → Drepanocladus sendtneri agg.
- → Drepanocladus sendtneri (Schimp. ex H.Müll.) Warnst.
- → Drepanocladus simplicissimus Warnst.
- → Drepanocladus sordidus (Müll.Hal.) Hedenäs
- → Drepanocladus stagnatus Zarnowiec
- → Drepanocladus tenuinervis T.J.Kop.
- → Drepanocladus trifarius (F.Weber & D.Mohr) Broth. ex Paris
- → Drepanocladus turgescens (T.Jensen) Broth.
- → Drepanocladus uncinatus (Hedw.) Warnst.
- → Drepanocladus vernicosus (Mitt.) Warnst.
- → Drepanocladus wilsonii (Schimp.) Loeske