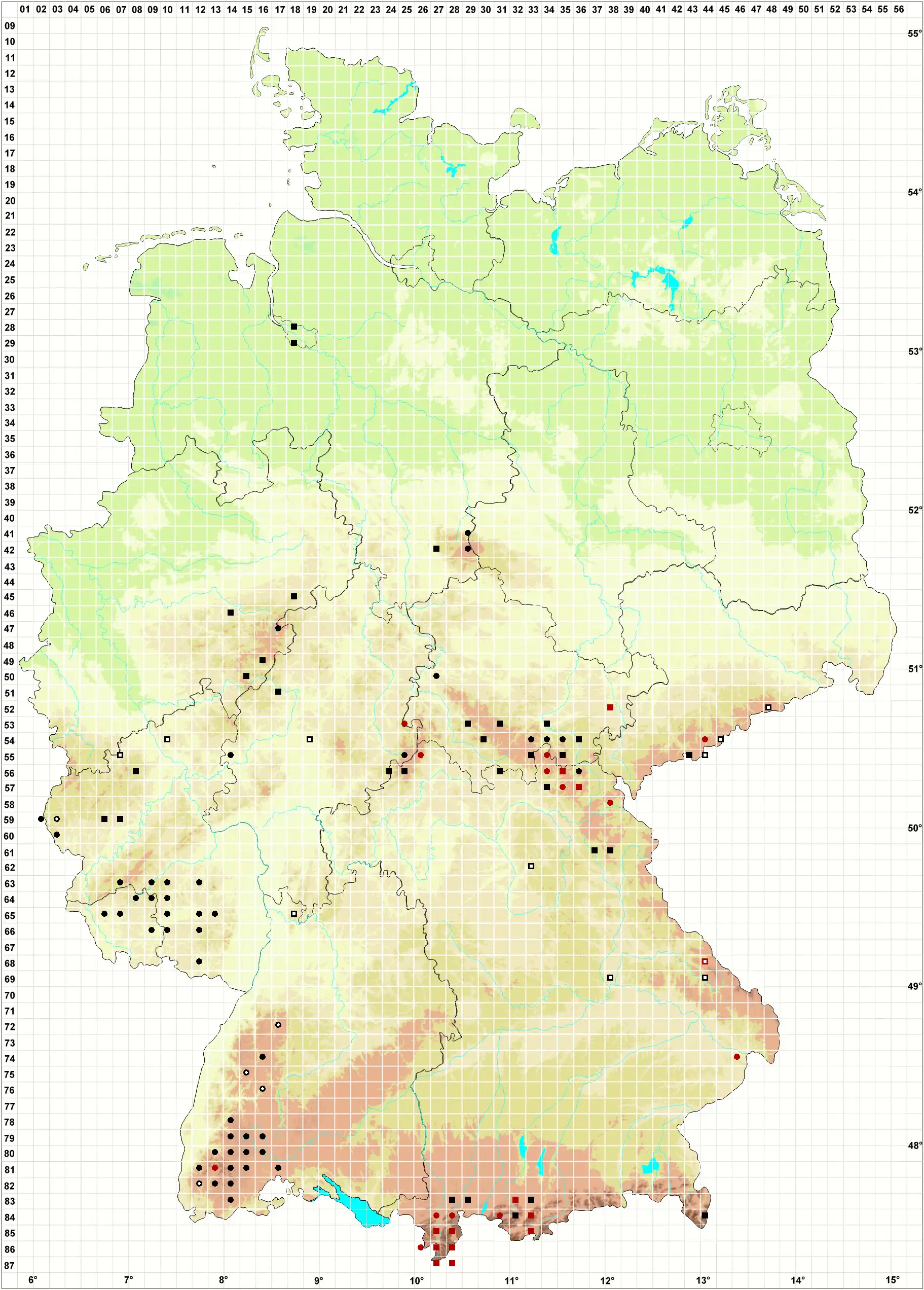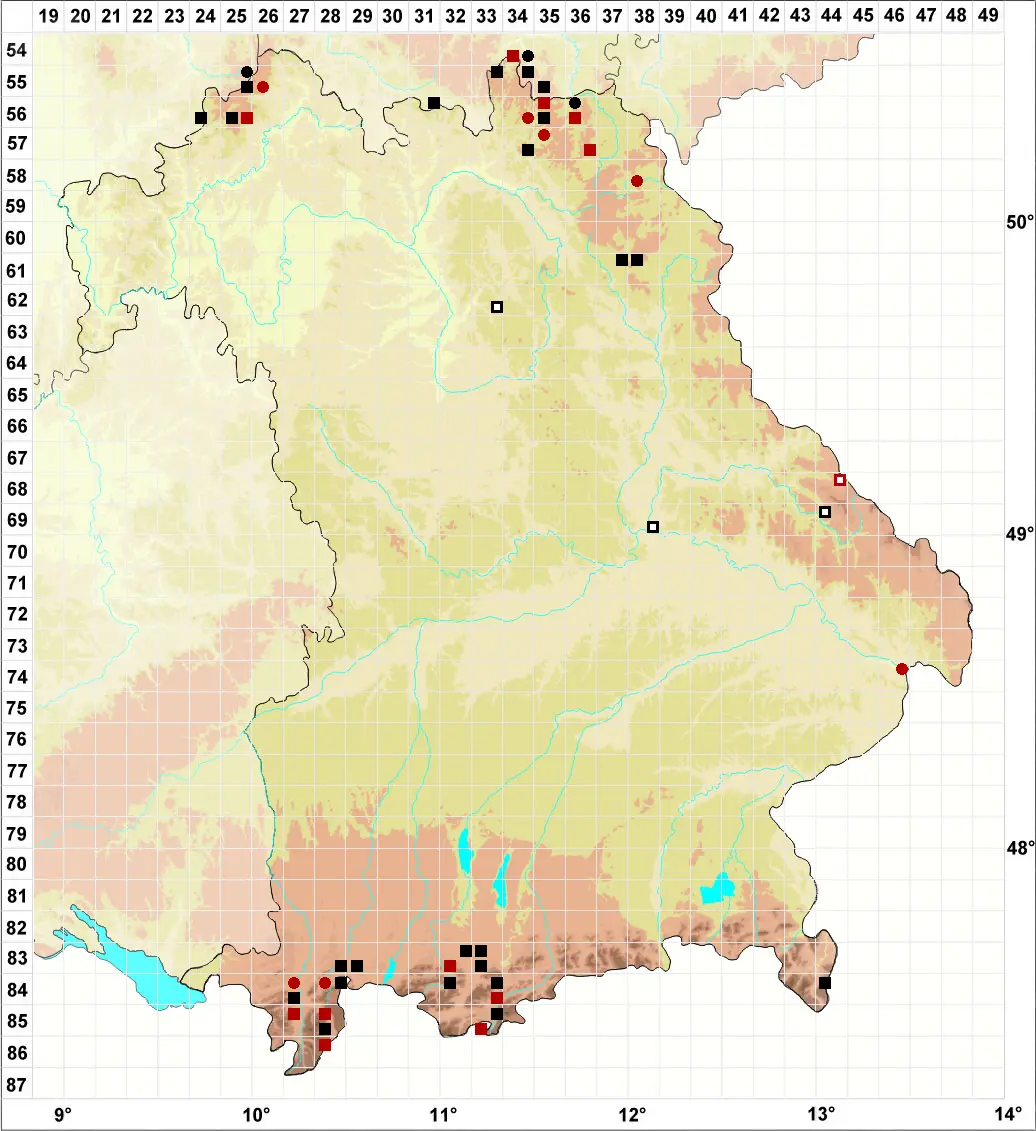
In unserer Datenbank gibt es 66 Datensätze .
Bitte klicken Sie die Karte für Details. [ Verbreitung in Deutschland ]
[ Verbreitung in Deutschland ]
Fertilität
Höhenverteilung
Rote Liste
- Deutschland (2018): *
- Bayern (2019): * / Alpen: * / kontinental: *
[ x ]
alpin: Alpen mit voralpinem Hügel- und Moorland
kontinental: Übriges Bayern
Gefährdungskategorien
Rote Liste 0 (Ausgestorben oder verschollen)
Rote Liste 1 (Vom Aussterben bedroht)
Rote Liste 2 (Stark gefährdet)
Rote Liste 3 (Gefährdet)
Rote Liste G (Gefährdung unbekannten Ausmaßes)
Rote Liste R (Wegen Seltenheit gefährdete Arten)
V Vorwarnliste
D Daten unzureichend
* Ungefährdet
♦ Nicht bewertet
Dürhammer, O. & M. Reimann (2019): Rote Liste und Gesamtartenliste der Moose (Bryophyta) Bayerns. – Bayerisches Landesamt für Umwelt Hrsg., Augsburg, 84 S.
Gebietseinteilungalpin: Alpen mit voralpinem Hügel- und Moorland
kontinental: Übriges Bayern
Gefährdungskategorien
Rote Liste 0 (Ausgestorben oder verschollen)
Rote Liste 1 (Vom Aussterben bedroht)
Rote Liste 2 (Stark gefährdet)
Rote Liste 3 (Gefährdet)
Rote Liste G (Gefährdung unbekannten Ausmaßes)
Rote Liste R (Wegen Seltenheit gefährdete Arten)
V Vorwarnliste
D Daten unzureichend
* Ungefährdet
♦ Nicht bewertet
Beschreibung der Art
Habitat/Ökologie (Meinunger & Schröder 2007)
Verbreitung (Meinunger & Schröder 2007)
Bestand und Gefährdung (Meinunger & Schröder 2007)
Verwandte Arten
- → Schistidium alpicola auct.
- → Schistidium alpicola auct. non (Hedw.) Limpr.
- → Schistidium alpicola var. latifolia (J.E.Zetterst.) Limpr.
- → Schistidium anodon (Bruch & Schimp.) Loeske
- → Schistidium apocarpum agg.
- → Schistidium apocarpum (Hedw.) Bruch & Schimp.
- → Schistidium apocarpum subsp. atrofuscum (Schimp.) Loeske
- → Schistidium apocarpum subsp. brunnescens (Limpr.) Loeske
- → Schistidium apocarpum subsp. papillosum (Culm.) Poelt
- → Schistidium apocarpum var. atrofuscum (Schimp.) C.E.O.Jensen
- → Schistidium apocarpum var. brunnescens (Limpr.) Loeske
- → Schistidium apocarpum var. confertum (Funck) H.Möller
- → Schistidium apocarpum var. grande (Poelt) Düll
- → Schistidium apocarpum var. homodictyon (Dixon) Crundw. & Nyholm
- → Schistidium atrofuscum (Schimp.) Limpr.
- → Schistidium boreale Poelt
- → Schistidium brunnescens Limpr.
- → Schistidium brunnescens Limpr. subsp. brunnescens
- → Schistidium brunnescens subsp. griseum (Nees & Hornsch.) H.H.Blom
- → Schistidium confertum (Funck) Bruch & Schimp.
- → Schistidium confusum H.H.Blom
- → Schistidium crassipilum H.H.Blom
- → Schistidium dupretii (Thér.) W.A.Weber
- → Schistidium elegantulum H.H.Blom
- → Schistidium elegantulum H.H.Blom subsp. elegantulum
- → Schistidium flaccidum (De Not.) Ochyra
- → Schistidium gracile (Röhl.) Limpr.
- → Schistidium grande Poelt
- → Schistidium helveticum (Schkuhr) Deguchi
- → Schistidium lancifolium (Kindb.) H.H.Blom
- → Schistidium maritimum (Sm. ex R.Scott) Bruch & Schimp.
- → Schistidium maritimum (Sm. ex R.Scott) Bruch & Schimp. subsp. maritimum
- → Schistidium platyphyllum (Mitt.) H.Perss.
- → Schistidium platyphyllum (Mitt.) Kindb. subsp. platyphyllum
- → Schistidium podperae Vilh.
- → Schistidium pruinosum (Wilson ex Schimp.) G.Roth
- → Schistidium pulvinatum auct. non (Hedw.) Brid.
- → Schistidium pulvinatum (Hedw.) Brid.
- → Schistidium pulvinatum var. flaccidum (De Not.) De Not.
- → Schistidium rivulare (Brid.) Podp.
- → Schistidium rivulare subsp. latifolium (J.E.Zetterst.) B.Bremer
- → Schistidium rivulare var. latifolium (J.E.Zetterst.) H.A.Crum & L.E.Anderson
- → Schistidium robustum (Nees & Hornsch.) H.H.Blom
- → Schistidium singarense (Schiffn.) Laz.
- → Schistidium sordidum I.Hagen
- → Schistidium spinosum H.H.Blom & Lüth
- → Schistidium trichodon (Brid.) Poelt
- → Schistidium trichodon (Brid.) Poelt var. trichodon
- → Schistidium trichodon var. nutans H.H.Blom